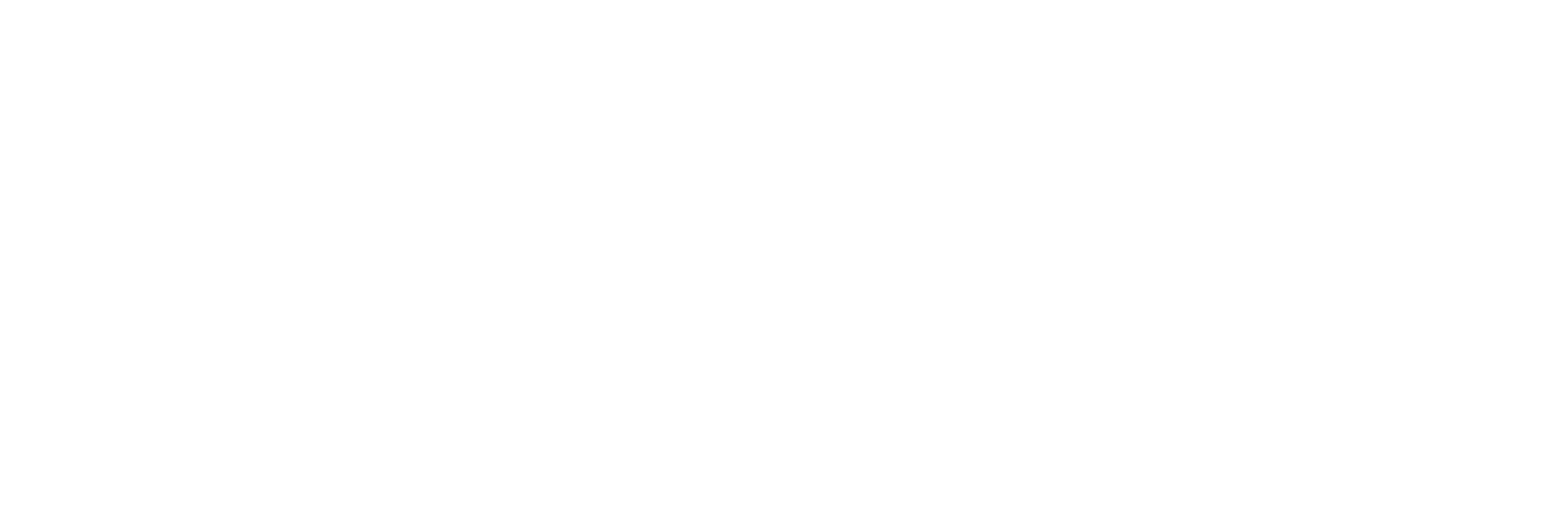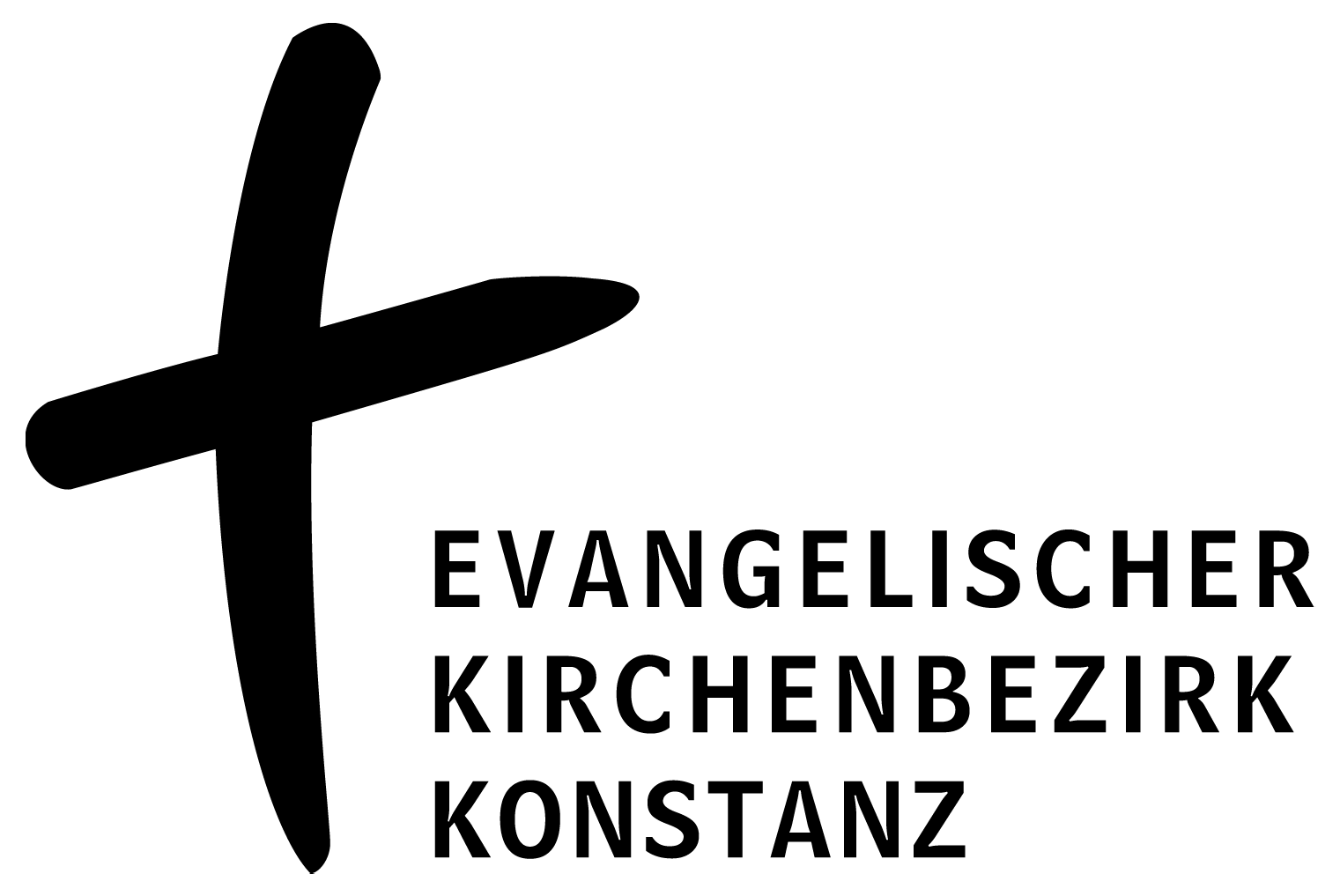Gott hat keine Hände - ein Portrait von Sabine Wendlandt
Gott hat keine Hände
(Ein Beitrag von Uli Fricker)
Sabine Wendlandt wurde ohne Arme geboren, dafür mit einem eisernen Willen.
Seit zehn Jahren dient sie als evangelische Pfarrerin auf der Reichenau.
Am Anfang legt sich erst einmal Verlegenheit über unsere Be- gegnung. Sabine Wendlandt sitzt in einem leuchtend grünen Kleid mit kurzen Ärmeln auf dem Sofa. Sie lächelt dem Besucher kurz zu, bevor sie sich weiter mit ihrem Handy be schäftigt. Das geschieht auf ungewöhnliche Art und Weise, denn die 63-jährige Frau schreibt ihre Nachricht mit dem linken Fuß. Den Stift zwischen zwei Zehen eingeklemmt, bewegt sie den schmalen Stift über den klei- nen Bildschirm, der sich bald mit Buchsta- ben füllt. Sie versendet den Text und ver- scheucht die erste Beklommenheit.
Sabine Wendlandt wurde ohne Arme geboren. „Meine Mutter hat ein einziges Mal Contergan genommen“, berichtet sie im Ge- spräch. Die einmalige Einnahme des Medikaments war ein Mal zu viel. Contergan war Anfang der Sechzigerjahre als Beruhigungs- und Schlafmittel groß beworben worden. Zahlreiche schwangere Frauen behalfen sich mit dem damals neuen Arzneimittel, bevor es 1961 aus dem Verkehr gezogen wurde. Die Tabletten, die man ohne Rezept in der Apotheke holen konnten, hatten entsetzliche Nebenwirkungen. Den Babys dieser Frauen fehlten Teile ihrer Gliedmaßen. Die Kinder wurden mit verkürzten Armen oder Beinen geboren oder mit unvollständigen Händen.
In Pforzheim kam ein Baby namens Sabine ohne Arme auf die Welt. 63 Jahre später erzählt diese Frau ihr Leben und die Vorgeschichte ihres Lebens ohne Sentimentalität. Sie denkt praktisch, lehnt sich nach vorne, ausgestattet mit einer un- geheuren Energie. Ihre Familie trauerte nicht, sondern überlegte, wie man den angeborenen Mangel ausgleichen kann. Arme sind sonst die nützlichsten und vielseitigsten Werkzeuge, welche die Evolution dem Menschen mitgibt. Wendlandt erzählt, wie das damals gemacht wurde: „Als ich drei Jahre alt war, stellte mich meine Mutter auf Skier. Sie sagte auf gut Badisch: ‚Do färsch‘ runner.‘ Also fuhr ich den Hang hinunter.“ Das Kind meisterte Schnee und Eis. Es steuerte die Bewegungen aus der Hüfte, setzte die Körpermitte ein, um die Kurven zu meistern. Diesem Sport blieb sie lange treu und bestritt früh Wettbewerbe. 1984 stand sie auf dem Siegertreppchen ganz oben. In Innsbruck holte sie bei den Paralympics (die damals noch anders hießen) eine Goldmedaille. Das Foto von damals zeigt eine kräftige junge Frau, die sich zwischen den Slalomstangen in die Kurve legt.
Das Bild hat nicht nur wegen der kraftvollen Bewegung eine Symbolkraft. Weite Strecken ihres Lebens gleichen einem Slalom mit plötzlichen Haken und Kurven. Es begann mit der Berufswahl. Am liebsten wäre sie Ärztin geworden, doch erkannte sie, dass dieser Beruf stark an manuelles Handeln gebunden ist. Warum nicht Pfarrerin?, so dachte sie damals. Jahre später reflektiert sie die Entscheidung und fasst es so zusammen: „Singen, lachen, weinen, denken, hören, sprechen und beten, das kann ich ja.“ Als Pastorin übt sie einen Geist- und Mundberuf aus. Das Studium lief glatt, doch in der Praxis türmten sich plötzlich Fragen auf, an die sie zuvor nicht gedacht hatte, zum Beispiel: Wie tauft eine Seelsorgerin ohne Arme?
In ihrer erzweiflung ließ sie Prothesen anfertigen, um dieses Sakrament spenden zu können. „Da war ich überehrgeizig“; bekennt sie in Rückblick. Ein geistlicher Begleiter wischte ihre Bedenken dann weg: Es komme doch aufs Wesentliche an, sagte er. Das manuelle Agieren sei zweitrangig. Sie besann sich auf ihre Füße, die ihre Hände sind, und klemmte sich damals einen Silberlöffel zwischen zwei Zehen, mit dem sie das Wasser schöpft und über den Kopf des Täuflings gießt.
Seit zehn Jahren dient sie als Pfarrerin auf der Reichenau, was an sich schon eine beträchtliche Herausforderung darstellt. Die Insel ist überwiegend katholisch. Nach dem Zweiten Weltkrieg trauten sich die ersten Protestanten auf das schöne Ländchen am Gnadensee. Sabine Wendlandt hat in dieser Diaspora einiges erreicht. Im Sommer lädt sie regelmäßig zur Seetaufe ein. Dann kom- men Familien aus dem ganzen Kreis Konstanz mit Sonnenschirm, Kühlkiste und Sippschaft, um sich dem biblischen Ritual anzuvertrauen. Dann steht die Theologin im schwarzen Talar im flachen Bodensee. Sie bittet die Kinder zu sich, die Familie bildet einen Kreis. Die Pastorin nimmt eine Jakobsmuschel zwischen die linken Zehen, füllt sie mit Seewasser und gießt das Wasser über den Kopf des Täuflings. Der Pate senkt sich dabei tief hinunter, fast mit den Knien im Wasser, das Kind schwebt knapp über der Wasserlinie. Ein Raunen geht durch die Menge, erfüllt mit Respekt. Das Ritual führt die Zerbrechlichkeit des Lebens vor. Ein kleines Kind hier – eine reife Frau dort, die bis heute von sich sagt: „Unter Millionen Menschen, die Arme haben, wurde ich als Mensch ohne Arme geboren.“ Über ihre Vita setzt sie einmal folgende Überschrift: „Christus hat keine Hände.“
Mit ihrem Los hadert sie heute nicht mehr. Von anderen die Pastorin ist Eberhard Franz deshalb einer der wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Der Mechaniker Franz, der selbst keine Arme besaß, tüftelte bereits in den Sechzigerjahren an einem Auto, das mit den Füßen gelenkt werden kann. Ein solches Modell fährt Wendlandt. Dem Tüftler Franz ist sie bis heute dankbar. Ihr Fahrzeug mit dem vollgepackten Fußraum sichert ihr Unabhängigkeit, und die war ihr wichtig.
Sie hat erreicht, dass sie selbstständig leben kann, ohne dauernd andere um Hilfe zu bitten. Menschen und häufig Mitchristen wurden ihr genug Steine in den Weg gelegt. In den ersten Jahren als junge Pfarrerin, als sie sich für eine Stelle bewarb, war auch leises Murren vernehmbar – wegen einer Pfarrerin, die von einigen Gemeinde- mitgliedern als unvollständig empfunden wurde. Bei einer Trauung beschwerte sich der Brautvater: Er wünsche sich „erstklassiges Personal“, so wörtlich. Wenn seine Tochter heirate, sollte es doch eine perfekte Hochzeit werden.
Es erstaunt nicht, dass Sabine Wendlandt in ihrer zweiten geteilten Stelle mehr Anerkennung findet – dort, wo man sie nicht unbedingt erwarten würde.
Die Hälfte ihrer Arbeitszeit verbringt die Pfarrerin der Badi- schen Landeskirche am Zentrum für Psychiatrie (ZfP). Sie freut sich immer, wenn sie in ihr speziell ausgerüstetes Auto klettert und das Reichenauer Festland ansteuert. Ihre prägende Erfahrung lautet: „In der Psychiat- rie sind die Leute normaler als woanders.“ Sie genießt dort Anerkennung, ist bekannt wie ein bunter Hund, wie sie selbst sagt. Sie berichtet von Leuten in der Forensik. Sie wurde nie bedroht. Ehemalige Kriminelle lassen sie ihn Frieden, wenn sie der kleinen Frau im weitläufigen Gelände begegnen. Sie steht im Gelände der Anstalt unter einem unsichtbaren Schutz.
Normalität begegnet ihr auch im Mitgefühl, das viele Patienten dort an den Tag legen. Sie hat im Laufe der Jahre Folgendes beobachtet: „Wenn in der Psychiatrie jemand im Sterben liegt, dann verabschieden sich die anderen Patienten von ihm.“ Man lässt den Leidensgefährten nicht ungesehen gehen. Anonymes Sterben gebe es kaum, berichtet sie. Hier kann sich keiner davonschleichen. Die Psychiatrie empfindet sie als ungewöhnliche und wohltuende Gemeinschaft. Alle seien auf ihre Weise vom Leben gebeutelt und getroffen. Und sie steckt mitten drin.
Die Arbeit in der Psychiatrie wird sie vermissen, wenn sie im Herbst in den Ruhestand tritt. Ebenso die kleine Kapelle, die da- zu gehört und in der Ökumene ohne großes Aufheben praktiziert wird.
Sie lebt und überlebt mit vielen praktischen Tricks. Wo die Arme nicht gewachsen sind, müssen die Füße ran und der Mund. Sprechen macht durstig, der Besucher schenkt ihr das Glas voll. Sie achtet beim Trinken stets auf Gefäße mit einem dicken Rand; ein Weinglas wäre völlig ungeeignet. Sie beugt sich zum Glas hinunter, nimmt es zwischen die obere und untere Zahnreihe und legt den Kopf in den Nacken. Und trinkt es in einem Zug leer.
Auch den Alltag im Pfarrbüro meistert sie mit einer speziellen
Methode. Auf ihrem Laptop schreibt sie mit dem linken Fuß mit Stiften. Das Telefon ist so an der Wand befestigt, dass sie es mit der rechten Schulter lösen und zwischen Schulter und Backe halten kann. Unterlagen oder Papiere breitet die Pfarrerin am Boden aus, da kann sie das Material spielend mit den Zehen dirigieren. Was wie Unordnung am Boden wirkt, dient ihr als stützende Struktur. Es ist ihre Ordnung.
Wer sagt, dass ein Büro nur am Schreibtisch stattfinden kann? Alle täglichen Fußgriffe absolviert sie mit Kraft und Unauffälligkeit. Sie sind eingeübt, es läuft. Nur manches Mal kann es sein, dass sie einen Schlüssel verlegt – den deponiert sie gelegentlich im Schuh.
Und noch eine Herausforderung: Vor 33 Jahren kam Sohn Simon auf die Welt. Ihr Mann Johannes half in vielem, beim Wickeln und im Haushalt ebenso. Doch wollte sie auch alleine mit dem Baby zurechtkommen. Ein bekannter Schreiner zimmerte ein spe- zielles Kinderbett, das sie mit dem Fuß bewegen und deichseln konnte. Den kleinen Simon wickelte sie am Boden. „Das war keine große Sache“, sagt sie. Inzwischen ist Simon groß und stark, er steht auf eigenen Füßen.